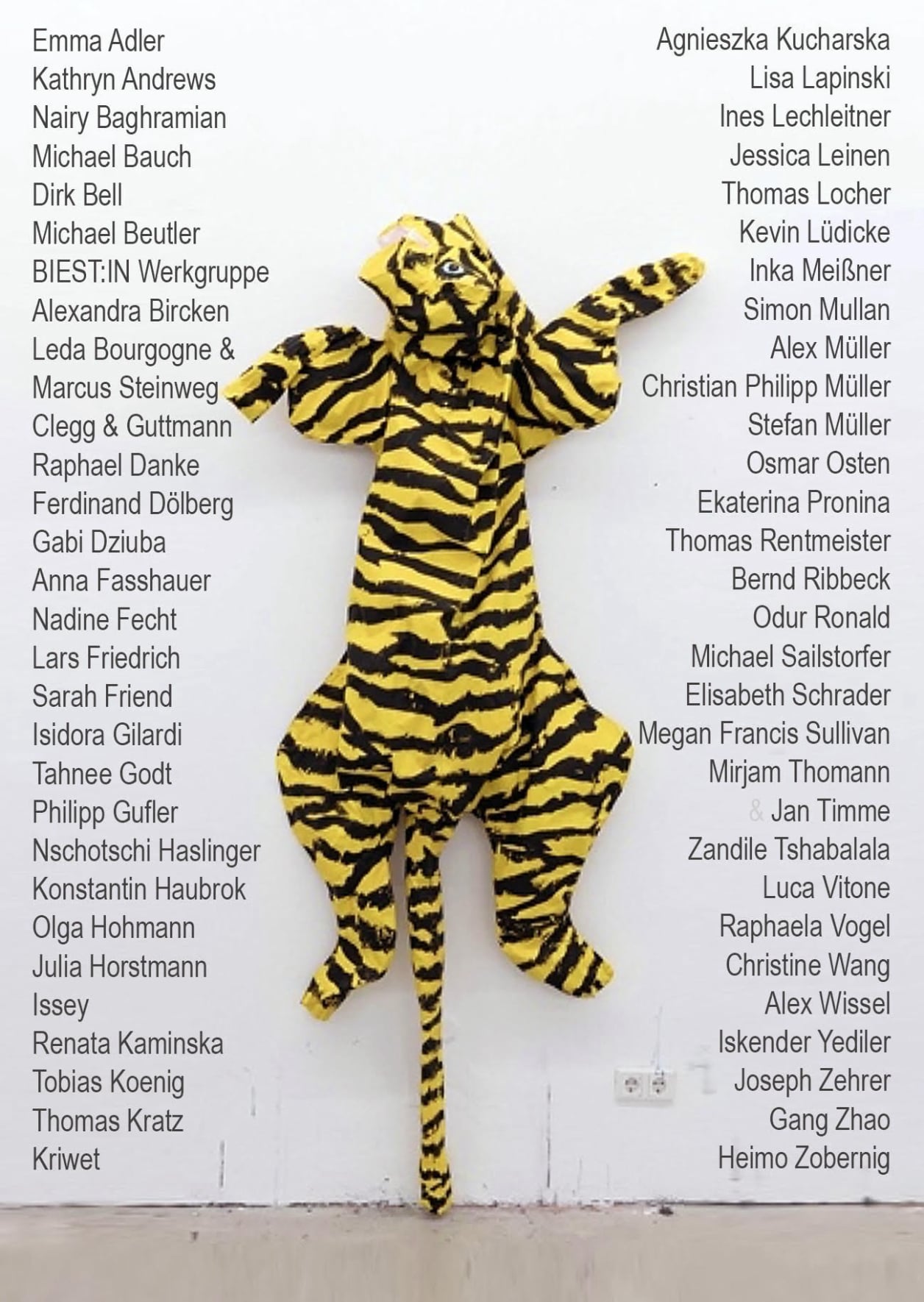am Platz
die SteDi Sammlung trifft auf Künstler*innen vom Platz
eine Hommage kuratiert von Frank Hauschildt
12. September bis 4.Oktober 2025
Eröffnung: 11. September, 18-22 Uhr
Donnerstag, Freitag, Samstag 14-18 Uhr
und nach Vereinbarung
Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz
Rosa-Luxemburg-Str. 45, 10178 Berlin
Volksbühne und Galerien, Concept Stores und Babylon, Kunstverein und die dort lebenden Künstler*innen:
Der Rosa-Luxemburg-Platz ist eine Ausnahme in Berlin, fast alles ist anders.
Die Ausstellung umfasst Positionen aus der SteDi Sammlung sowie Werke von Akteur*innen des Platzes, die sich jetzt hier im Plattenbau begegnen.
Abb.: Heimo Zobernig - o.T. (Tiger), 2022